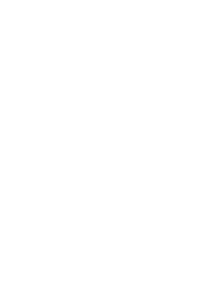Viele Frauen, die aus den unterschiedlichsten Gründen ihr Land verlassen mussten und in Ländern wie Deutschland landeten, erleben dort zum ersten Mal, was es heißt, Flüchtlinge zu sein – ein vorläufiger und doch auch dauerhafter Status.
Eine neue Umgebung, neue Gesichter, eine andere Sprache, ein spezieller amtlicher Status und ein Gefühl zwischen Angst und Sicherheit, Schwäche und Stärke: Die meisten betroffenen Frauen hatten nicht erwartet, dass die für sie neue Flüchtlingsidentität ihnen so anhaften würde! Viele von ihnen würden sie gerne ablegen und unter Beweis stellen, dass sie Teil der neuen Gesellschaft sein können. Andere nehmen sie an und verinnerlichen sie, und wieder andere Frauen sind entschlossen, sich ihre jeweils eigene Identität zu schaffen.
Und inmitten all dieser komplexen Veränderungen in ihrem Leben werden diese Frauen dann auch noch Mütter – sei es aus eigener Entscheidung oder nicht – und müssen dabei mit ihrer neuen Zuschreibung ebenso kämpfen wie mit nie gekannten Gefühlen, allerdings mit nur wenigen Mitteln, damit umzugehen: Ihre sozialen Kontakte sind begrenzt und die neue Sprache will einfach nicht zur Verständigung taugen. Sie sind Mütter in grenzüberschreitenden Familien – ihre eigenen Mütter, Väter, Großeltern und Geschwister sind oft noch im fernen Herkunftsland, ebenso die Freundinnen und Nachbarinnen von früher. Die Funktion als Mutter, die viele Frauen und Männer als gleichsam selbstverständlich für jede Frau ansehen, müssen sie so oder so übernehmen, ja sie sind geradezu dazu verpflichtet, diese mit größter Verantwortung zu versehen und dabei noch höchst zufrieden zu sein. Denn traditionellerweise wird eine Frau ab ihrer Geburt von ihrer Familie und der Gesellschaft sowie politisch, religiös und wirtschaftlich darauf vorbereitet, Mutter zu werden. In der Migration sind ist jedoch mit gänzlich davon verschiedenen Voraussetzungen dafür konfrontiert.
Zur Erklärung: Ich selbst bin noch keine Mutter. Ich bin eine Migrantin, und viele Männer und Frauen erwarten auch von mir, dass ich eines Tages Mutter werde, und vielleicht erwarte ich es sogar von mir selbst. Seit ich in Deutschland bin, erlebe ich jedenfalls, wie manche meiner hierher geflüchteten syrischen Freundinnen zu Müttern werden – mit Partner oder ohne – und erlebe Ausschnitte aus ihrem Alltag, der oft von Ohnmacht, Angst, Erschöpfung und Einsamkeit geprägt ist. Ich habe bei meinen Recherchen viele syrische Mütter in mehreren deutschen Städten kennengelernt und ihnen zugehört. Vor allem habe ich mit ihnen über ihre Identität als Frauen gesprochen, die selbst wählen möchten, wer sie sein möchten und die darüber nachdenken, wie sie angesichts all ihrer hier neu erworbenen Identitäten dennoch sie selbst sein können. Viele von ihnen aber sind erschöpft, fühlen sich gefesselt und manche von ihnen sind dabei, sich selbst für lange Zeit aufzugeben. Sie unterliegen noch einem Mutterbild aus der Zeit, als sie noch in einem Land lebten, dessen Codes sie kannten, unterliegen im neuen Land aber Vorgaben, die gerade ihrem Flüchtlingsdasein geschuldet sind. Hier wird oft über sie hinweg entschieden, wie sie Frauen und Mütter zu sein haben, und ihnen und ihren Partnern wird vorgegeben, welche soziale und familiäre Rolle sie übernehmen sollen, wer von ihnen arbeiten geht, wer zu Hause bleibt, wer am Sprachkurs teilnimmt usw. Dazu kommen die Pflichten der Mutterschaft selbst, denen sie aufs Beste nachkommen möchten, um sich und ihrem Umfeld zu beweisen, dass sie trotz aller schwierigen Umstände, die sie nicht müde werden aufzuzählen, gute Mütter sind. Niemand nah oder fern soll sie für schwach oder nachlässig halten – auch sie selbst nicht.
Erstrebte und erzwungene Identität im Exil
Die Entscheidung zur ersten oder wiederholten Mutterschaft haben viele geflüchtete syrische Frauen in Deutschland selbst getroffen – neben vielen anderen Entscheidungen im Zusammenhang mit persönlicher Weiterentwicklung, einem erstrebten Abschluss oder der Aufnahme einer Arbeit. Viele dieser Frauen gaben mir gegenüber ihrem Wunsch Ausdruck, Mutter zu werden oder eine Familie zu gründen, um einen Anker im Leben zu haben und darauf aufbauend ihr Berufs- oder Arbeitsleben zu beginnen oder wiederaufzunehmen. In Syrien vermochten sie dies aufgrund von Krieg und Vertreibung nicht, weswegen sie es nun hier so gut sie können nachholen möchten. In einem Land wie Deutschland erscheint dies umso vielversprechender, als Kinder hier in vielfacher Weise versorgt und gefördert werden.
Aber die meisten dieser Frauen müssen feststellen, dass man in diesem Land ganz anders mit der Institution der Mutterschaft umgeht, zumal wenn es um Geflüchtete geht. Denn wie eine junge Frau Mutter wird und wie sie diese Rolle ausübt, hat auch viel damit zu tun, was das Arbeitsamt entscheidet und welche Asylpolitik praktiziert wird. Viele Frauen schilderten mir, dass sie wegen ihrer Schwangerschaft aufhören mussten zu arbeiten oder zum Deutschkurs zu gehen und dass dies auch nach der Entbindung für ein Jahr oder länger so blieb. Viele von ihnen versuchen die Ämter davon zu überzeugen, dass sie weiterhin Deutsch lernen könnten, aber die Behörden seien der Meinung, dass Schwangere beziehungsweise Mütter besser zu Hause bleiben, weswegen sie sich in dieser Zeit keine Fähigkeiten aneignen können, die ihrer Integration zugutekämen, die sie mit dem Land vertraut machen oder ihrer Selbstverwirklichung dienen könnten. Und so sitzen sie dann mit ihren Kindern in der Wohnung und spielen die perfekte Mutterrolle, ohne dass – anders als in Syrien – ihr Umfeld sie dabei unterstützt. Sie können nur darauf hoffen, dass die Ämter ihnen hin und wieder etwas bewilligen. In Syrien, wo es kein System zur Unterstützung der Elternschaft wie in Deutschland gibt, gestaltet sich das Muttersein ganz anders. Dort versorgen alle Frauen der Familie, das soziale Umfeld und zuweilen auch verwandte Männer die Kinder mit – ein Bezugssystem, das auch in Afrika weit verbreitet ist und das die afroamerikanische Forscherin Patricia Hill Collins mit „Othermothering“ umschreibt.
All diese für geflüchtete junge Frauen geltenden Begleitumstände bringen viele von ihnen in einen Konflikt zwischen der Mutter, die sie gern sein möchten, aber nicht sein können, weil sie nur sehr begrenzt autonom entscheiden können, und der Frau, die persönlich vorankommen und sich Lebensziele setzen möchte. Die genannten Identitäten lassen sich zwar nicht scharf voneinander abgrenzen, aber die Asylpolitik schafft einen Gegensatz zwischen ihnen, obgleich diese sich in vielen Bereichen überschneiden und sich gegenseitig verstärken könnten. Doch das wird erschwert, wenn die betroffenen Frauen sich in vorgefertigte Identitäten fügen müssen, anstatt diese selbstbestimmt auszugestalten.
Eine solche Politik zwingt viele geflüchtete Frauen dazu, sich zwischen Mutterschaft im Privaten und einem Leben im öffentlichen Raum zu entscheiden, so als seien sie als Geflüchtete nicht in der Lage, beides zu vereinbaren, und unterstützt zugleich ihre männlichen Partner dabei, weiter Deutsch zu lernen, zu studieren oder eine Berufsausbildung zu machen, während die Frau sich nur um das Kind kümmern soll. Das verstärkt und reproduziert stereotype Genderrollen, schränkt ein partnerschaftliches Modell ein und bestätigt das Bild von der Frau, die in erster Linie für die Kinderpflege verantwortlich sein soll.
Dürfen in Deutschland nur Frauen, die nicht geflüchtet oder migriert sind, selbst entscheiden, wie sie ihr Leben als Frauen oder Mütter organisieren? Gibt es eine Grundannahme, dass geflüchtete Frauen weniger in der Lage sind als andere, Lebensentscheidungen zu treffen? Jede Frau sollte selbst über sich und ihr Leben bestimmen können, und auch Frauen, die sich zur Flucht gezwungen sahen, sollten in diesem Land alle Rechte haben und ihre Muttererfahrung sowie unterschiedliche Konzepte von Mutterschaft einbringen können. Die für Entscheidungen in der Asylpolitik Verantwortlichen sollten bei Maßnahmen, die die Lebensführung und Zukunft geflüchteter Mütter betreffen, diese miteinbeziehen, statt ihnen diese Bestimmungen einfach aufzuzwingen und davon auszugehen, sie würden schon damit zurechtkommen.