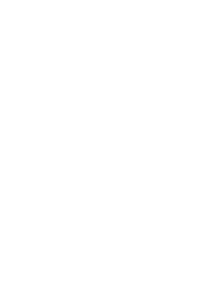Das Verhältnis geflüchteter Frauen zur Öffentlichkeit und zur Presse in ihren Zufluchtsländern trägt unklare Züge. Sicher ist eigentlich nur, dass die betroffenen Frauen mit dem von ihnen gezeichneten Bild unzufrieden sind, und zugleich scheint es recht schwer zu sein, die Art und Weise zu verändern, wie sie dargestellt werden. Das mag zum einen daran liegen, dass die Medien hier in Deutschland und anderswo andere Prioritäten haben, zum anderen aber gibt es ein scheinbar starres Framing, in das die betroffenen Frauen sich zu fügen haben, ob sie sich darin widererkennen oder nicht.
Aber könnten geflüchtete Frauen nicht auch selbst ein Framing schaffen, das ihnen gerecht wird? Wie wäre es, wenn sie sich selbst ein eigenes Image aufbauten?
Wir geflüchteten Frauen diskutieren seit Jahren über kulturell geartete Empfindlichkeiten, die sich zwischen uns und der Aufnahmegesellschaft (beispielsweise der deutschen) auftun und beklagen dabei, die Deutschen wüssten zu wenig über uns, unsere Kultur, unsere Gewohnheiten und unsere Hintergründe. Wir sind wütend über uns entgegengebrachte Geringschätzung und versinken in Bedrückung darüber, dass wir es mit einer Gesellschaft, einer Kultur, einer Arbeitswelt und einer Behördenstruktur zu tun haben, die jeweils ganz anders ist als alles, was wir aus unserer Heimat Syrien kannten. Auch unser Familienleben hat sich hier so verändert, dass es uns hilflos macht. Unser Verhältnis zu unseren Ehepartnern, unseren Kindern und Verwandten hat sich gewandelt. Dazu kommen noch Rassismus und Diskriminierung, die wir im Arbeitsumfeld, in Bildungsstätten, im Nahverkehr usw. erleben. Aber es reicht nicht, auf Rassismuserfahrungen zu verweisen. Wenn wir Fairness einfordern, müssen wir selbst aktiv werden und uns so darstellen, wie es uns und unserer Kultur zusteht.
Mehrere Ebenen in uns geflüchteten Frauen verlangen nach Ausdruck, als Mütter oder Kinderlose, als Arbeitende oder Arbeitslose, als Integrierte oder Nichtintegrierte, als in Deutschland Glückliche oder nicht Glückliche – und ich meine „Glück“ hier als Teil unserer jeweiligen Identität. Eine Identität, die von Umständen beeinflusst wird, die wir nicht selbst bestimmen, sondern die entweder gegeben oder nicht gegeben sind.
Unsere weiblichen Identitäten umfassen natürlich noch mehr. Entscheidend ist, dass wir dies sichtbar machen, es transparent und ehrlich zum Ausdruck bringen und davon ausgehend die Herausforderungen und Chancen benennen, die sich uns in unserer neuen Heimat, wenn wir sie so nennen dürfen, darbieten.
Für uns, die wir aus Gesellschaften des Schweigens und der Schamhaftigkeit kommen (beides gilt dort auch als guter Wesenszug von Frauen, und man bringt uns bei, danach zu leben), ist es durchaus ungewöhnlich beziehungsweiseheikel, unseren weiblichen Identitäten Ausdruck zu verleihen. Was aber hindert uns daran, hier, wo wir theoretisch vom gesellschaftlichen Druck unserer Heimat befreit sind und nicht mehr wie selbstverständlich jedes Details unseres Lebens beobachtet wird? (In Syrien war es das Recht aller, vom nächsten Angehörigen bis zum Nachbar im letzten Haus des Stadtviertels, sich in das Leben einer Frau einzumischen.)
Aber so traurig es ist, wir ziehen es meist auch hier noch vor zu schweigen. Wir möchten nicht, dass unser echter Name – die erste unserer Identitäten – unter dem von uns Geschriebenen steht. Wir möchten keinesfalls Familiengeheimnisse nach außen tragen. Also schreiben die meisten Frauen, die von ihren Konflikten als Ehepartnerinnen oder Mütter berichten, lieber unter Aliasnamen. Oft erreichten mich auch Bitten von Autorinnen, die beispielsweise über autoritäre Ehemänner geschrieben haben, ich möge doch bitte ihre Texte nachträglich abändern, mit dem Hinweis: „Mein Mann ist ein guter Mensch!“ Diese Priorisierung anderer, die syrischen Frauen aufgezwungen wird, ist eine große und grundlegende Last, und wenn sie dagegen anzugehen versuchen, wird ihnen auch noch nachgesagt, sie seien nur nach Europa gekommen, um sich scheiden zu lassen!
Dennoch bleibt das Schreiben, wenn auch nicht immer unter echtem Namen, für uns eine Möglichkeit, uns darzustellen, um Dinge zu verarbeiten, die uns beschäftigen, oder sie zumindest einmal vor uns selbst zu benennen, wenn wir sie schon mit sonst niemandem teilen. Darüber zu schreiben ermöglicht uns, die Dinge besser zu verstehen, und es kann uns Mut machen, sie zu analysieren. Und schließlich können wir das Bild korrigieren, das andere von uns haben, indem wir uns so präsentieren, wie wir möchten und wie es uns angemessen erscheint.
Geflüchtete Frauen können die Grundlage für ein neues Wissen werden, das wir selbst schaffen müssen: Ein gesellschaftliches, kulturelles und zivilisatorisches Wissen, das nach und nach die Art verändert, wie auf uns geblickt wird. Wir können damit auf Seiten der Aufnahmegesellschaft ein Gegenwissen und einen Gegendiskurs herstellen, der uns besser gerecht wird. So eröffnet sich ein Raum für einen kulturellen Dialog über Identität auf Augenhöhe, der den menschlichen Wert jeder Einzelnen von uns achtet.
Aus dem Arabischen von Günther Orth